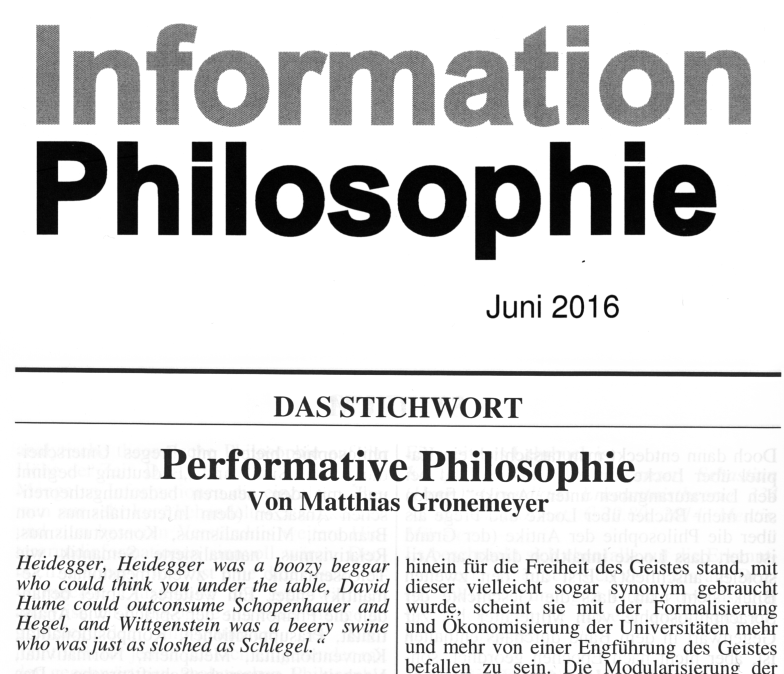Mein Beitrag zum Stichwort „Performative Philosophie“ erschien in der Ausgabe 2 (Juni) 2016 der Zeitschrift Information Philosophie.
Hier der vollständige Text zum Nachlesen und als PDF.
Performative Philosophie
Von Matthias Gronemeyer
Heidegger, Heidegger was a boozy beggar who could think you under the table, David Hume could outconsume Schopenhauer and Hegel, and Wittgenstein was a beery swine who was just as sloshed as Schlegel.“
Das bekannte Lied der englischen Komikertruppe Monty Python über die Performance berühmter Philosophen in Sachen Alkohol ironisiert zum einen den Betrieb der Philosophie, droht zum anderen aber ins völlig Unernste abzukippen. Damit berührt es zwei für das Thema „Performative Philosophie“ wichtige Punkte: Einmal den gegenwärtigen Zustand der Philosophie als akademisches Fach, der offensichtlich Anlass gibt, über erweiterte Formen des „denken tun“ nachzusinnen, dann aber auch die Frage, inwieweit das, was da auf einer Bühne passiert, philosophischen Geltungsanspruch erheben darf: Professoren schlüpfen in die Rolle ihres Lieblingsphilosophen und spielen (sehr belesen!) Talkshow, jemand setzt sich nackt in eine Badewanne und rezitiert Nietzsche, ein dritter verfasst ein „philosophisches Manifest“ und verbrennt es auf der Bühne oder jemand peppt seinen „klassischen“ Vortrag mit etwas New Jazz auf – dies sind einige Beispiele für Aktivitäten, die man in den letzten Jahren unter dem Etikett „performative Philosophie“ beobachten konnte. Zugegebenermaßen Beispiele, die die Notwendigkeit einer performativen Erweiterung des Denkens nicht umstandslos belegen. Sie sind aber zumindest Symptome einer Entwicklung der jüngeren Philosophiegeschichte und ihr Anlass ist ein durchaus ernster.
Performative Philosophie als Symptom einer akademischen Krise
Wenn man sich die Entwicklung der Philosophie als akademisches Fach in den letzten Jahren anschaut, dann mag einen ein gewisses Unbehagen befallen. Wo das Etikett „Philosophie“ noch bis in die 1990er Jahre
hinein für die Freiheit des Geistes stand, mit dieser vielleicht sogar synonym gebraucht wurde, scheint sie mit der Formalisierung und Ökonomisierung der Universitäten mehr und mehr von einer Engführung des Geistes befallen zu sein. Die Modularisierung der Studiengänge, die epidemische Einrichtung von spezialisierten Forschungsgruppen, die im engen Zeitkorsett um Drittmittel konkurrieren, die Verdrängung des Buches durch das paper in international journals, der Elitarismus der Karrieren – insgesamt die Orientierung an den amerikanischen sciences stecken für einen zunehmend engen Rahmen.
Auf der anderen Seite erfährt das Fach eine unübersehbare Popularisierung, um nicht zu sagen Trivialisierung durch etliche bunte Magazine und leichte Buch-Kost aus Verlagen, die sonst eher für Krimis und sonstige pulp fiction bekannt waren.
Mir erscheint dies als ein Symptom einer akademischen Krise. Die Philosophie hat es versäumt, sich selbst gegenüber eine kritische Position einzunehmen. Ihr Primat der Rationalität schlägt nun von zwei Seiten gegen sie zurück: Zum einen durch die (life-)sciences, die mit den immensen Erfolgen ihrer quantitativen Methoden den Diskurs beherrschen, zum anderen durch eine Untergrabung der Exklusivität des Logos, die das Philosophieren zu einer Art Lifestyle degradiert. Ihrer ursprünglichen Aufgabe, nämlich das Denken (als kollektives Gut) voranzubringen (und darüber zu einem besseren Verständnis der Welt zu gelangen), kann die Philosophie unter diesen Bedingungen nurmehr schwer nachkommen. Es war also nur eine Frage der Zeit, dass man sich hie und da anschickte, einen dritten Weg zu beschreiten, der zwischen Engführung und Banalisierung eine Perspektive ins Offene verhieß. Was hier nun unter dem Etikett „performative Philosophie“ seit einigen Jahren im Schwange ist, ist also vorrangig als Methodenkritik inklusive methodischer Neuausrichtung zu verstehen.
Was nun ist unter Performance bzw. performativer Philosophie im engeren Sinne zu verstehen?
Was tut jemand, wenn er philosophieren „machen tut“? Es muss offensichtlich mehr sein als das übliche Lesen und Schreiben von Büchern, das Vorlesen in Hörsälen und Diskutieren in Seminaren – denn sonst bedürfte es dieses Zusatzes „performativ“ ja nicht. Die eingangs genannten Beispiele legen nahe, dass das Adjektiv hier additiv verwendet wird, performative Philosophie also Philosophie plus Performanz, Handlung, Aktion oder was auch immer ist.
Hilfreich scheint es zunächst, das Adjektiv differenzierend zu verwenden, so wie es in „französischer“ oder „analytischer“ Philosophie geschieht. So könnte man die performative Philosophie unter die diversen Schulen rechnen, die sich über die Zeit gebildet haben (und auch wieder verschwunden sind). Abgesehen davon, dass damit eine inhaltliche Bestimmung aber noch nicht gegeben ist, ist diese Verbindungslinie nicht so ohne Weiteres zu ziehen.
Kaum eine Publikation zum Stichwort Performativität kommt ohne Rückgriff auf John Austins Theorie des sprachlichen Handelns aus. Austin hatte mit seinen Untersuchungen zum Handlungscharakter sprachlicher Äußerungen den Begriff „performativ“ erstmals geprägt. Ausgehend von Sätzen wie „Ich erkläre Sie hiermit zu Mann und Frau“, die nicht einen Sachverhalt referenzieren, sondern ihn vielmehr hervorbringen, dehnt er den Befund auf sämtliche Akte des Sprechens aus und weist ihnen generellen Handlungscharakter zu. Auch auf den ersten Blick rein konstative Sätze („Plotin war ein Neuplatoniker“) haben ihm zufolge einen performativen Charakter. Eine Äußerung ist in der Folge nicht mehr richtig oder falsch, sondern gelungen oder missglückt. Gelungen dann, wenn die Intention des Sprechenden vom Angesprochenen umgesetzt wird (er „richtig“ reagiert, das Gewünschte tut, eine Bedeutung erfasst etc.). Austin stellt dazu dann eine Reihe von Regeln auf, die einen Sprechakt gelingen lassen. Vor diesem Hintergrund könnte man zu dem Schluss kommen, die Philosophie sei schon immer performativ, jede Vorlesung eine lecture performance. Die methodologische Kritik der performativen Philosophie, dass die Philosophie selbst ein Reduktionismus sei, könnte also mit diesem Verweis auf ein „immer schon“ abgewehrt werden. Mit seiner Fokussierung auf den gelingenden Sprechakt bleibt Austin aber weiterhin einem Verweisungszusammenhang verhaftet, der dem Schema prädikativer Sätze folgt; er verpasst es, seinen Befund auf sich selbst anzuwenden. Es würde hier zu weit führen, noch einmal die ganzen Problematiken aufzurollen, die sich aus der Definition von Handlung als intentionalem Tun ergeben; indem Austin dem „scheiternden“ Sprechakt aber so wenig Aufmerksamkeit schenkt, geht ihm einiges verloren. In ihrer Fixation auf wahre oder falsche Sätze ist die Philosophie also eben nicht schon immer performativ.
Die Gefahr des Scheiterns
Es ist die Gefahr des Scheiterns, auf die sich die Performerin einlässt, und die die performative Philosophie damit von anderen Bindestrich-Philosophien unterscheidet. Diese Gefahr des Scheiterns macht den Kern der künstlerischen Performances von Marina Abramović aus, die durch ihre Arbeiten das, was wir unter Performance verstehen, nachhaltig definiert hat. Mit The Artist is present (drei Monate täglich sieben Stunden regungslos auf einem Stuhl im MoMA New York), Pfeil und Bogen (sie hält minutenlang einen Jagdbogen mit Pfeil auf sich gerichtet, dessen Sehne von ihrem Lebensgefährten Ulay gespannt wird) oder The Lovers (sie und Ulay laufen von beiden Enden der chinesischen Mauer aufeinander zu – ironischerweise geht ihre Beziehung über das Projekt in die Brüche) hat sie gezeigt, was Performance ist – und vor allem was sie nicht ist: sie ist kein bloßes Happening und auch kein Theater. Der Performerin ist es ernst, lebensbedrohlich ernst. Ohne die Bereitschaft zu scheitern, so formuliert es Abramović selbst, würde man die Kunst letztlich verfehlen. Auf dieser Spitze, auf der Möglichkeit vollständig zu scheitern, müssen wir die Performance fassen, um sie von allem „als ob“, von allem szenischen Tamtam abzugrenzen. Insofern ist die Performance auch kein Theater, kein Schauspiel und das Theater keine Performance, weil das Theater beim gefahrlosen „als ob“ der Simulation verharrt (unbenommen natürlich, dass sich ein Schauspieler auch um Kopf und Kragen spielen kann). Als solches taugt es nicht zur Produktion von Erkenntnis und Wahrheit, weil es „sein Leben nicht wagt“, wie Hegel es ebenso dunkel wie einleuchtend (in anderem Zusammenhang) formulierte. Das Theater der Wahrheit müsste schon ein „Theater der Grausamkeit“ sein (A. Artaud), ein Stück, das nur einmal aufgeführt werden kann. Das Theater ist Präsentation von etwas, das anderswo stattgefunden hat, als Präsenz hat es keine Existenz, es ist nur die halbe Seite, die äußere, wenn man so will, der Performance.
Philosophie ohne Schrift, ohne propositionalen Gehalt
Alles Ästhetische hat zwei Seiten: eine des Eindrucks und eine des Ausdrucks. In unserer sehr auf Präsenz ausgerichteten Welt blickt man vorrangig auf die Seite des Ausdrucks, alles konkurriert hier um Aufmerksamkeit. Es gibt aber keinen Ausdruck ohne Eindruck, und je schwächer die Eindrücke, die Erfahrungen sind, umso schwächer wird der Ausdruck sein. Das Eindruck/Ausdruck-Schema nennen wir in der Wissenschaft Forschung und Publikation. Auch hier liegt der Focus auf dem Ergebnis, der Schrift – nicht auf ihrem Zustandekommen. In der Schrift löst sich indes der Gedanke vom Vorgang des Denkens und des Denkenden, in ihr verleugnet er sein Herkommen. Das Denken ist aber ebensosehr ein Tun, ein aktives Erleiden, und erst, wenn man die Eindruck-Ausdruck-Bewegung in ihrer Gesamtheit erfasst, wird Wissen wirklich zu einer Erfahrung. Auf dieser Seite performativ zu philosophieren, hieße also, das Denken von seiner Hinsichtlichkeit auf die Schrift zu lösen (zu befreien) und sich ganz der Erfahrung hinzugeben, diesem „bacchantischen Taumel“ (Hegel), der weder Verwüstung noch Tod scheut.
Die Philosophie ist aber archaisch mit der Schrift verbunden, so dass wir sie uns kaum als ungeschriebene, nicht verschriftlichte vorstellen können. So, wie der Gedanke zwar in der Schrift aufgehoben wird, so stirbt er aber auch in ihr und wird endlich leere Worthülse. Auf der Seite des Eindrucks performativ zu philosophieren, hieße also, auf Lektüre zu verzichten, in einem weiteren Sinne auf Arbeit (als gefahrloser Bildung) und stattdessen die Gefahr zu suchen. Sokrates konnte seine Zuhörer zur Erstarrung bringen wie der Zitteraal (sie also ihren eigenen Tod quasi erleben lassen), weil er nicht schrieb, weil er nicht arbeitete – und weil er als Soldat im peleponnesischen Krieg dem Tod ins Auge geblickt hatte. Diesen Sokrates, der auch noch aus seinem Sterben ein Ereignis des Erkennens machte, muss Hegel vor Augen gehabt haben, als er schrieb: „Das Individuum, welches das Leben nicht gewagt hat, … hat die Wahrheit eines selbständigen Selbstbewusstseins nicht erreicht“. Wir sehen in Sokrates so den ersten und zugleich letzten philosophischen Performance-Künstler. Denn, für die Philosophie seit Platon symptomatisch, ist Hegel nicht bei dieser Gefahr geblieben, sondern hat in nicht einmal zwei Seiten den Ausweg zur Arbeit gefunden, zur Arbeit am Begriff, zur Arbeit des Geistes, und damit dem philosophischen Bewusstsein seinen Dienstplan erstellt. Der Poet und Ekstatiker unter den philosophischen Randexistenzen, Georges Bataille, hat zu Recht darauf hingewiesen, dass Hegel hier sich selbst gegenüber blind gewesen sei.
Die Performance, auch die philosophische, hat dagegen keinen propositionalen Gehalt, sie drückt kein Wissen in prädikativen Sätzen aus. Als philosophische Methode ist sie vielmehr spekulativ, nicht-referenziell. Sie zielt darauf, dass die Wahrheit im Spannungsfeld zwischen Performerin und Publikum, jenem elektrisierenden sokratischen Moment, emergiert. In der Doppelsinnigkeit des Moment-Begriffs, als Augenblick ebenso wie als bewegende Kraft, liegt zugleich die Unwiederholbarkeit der Performance begründet. Das Nichtwissen um das, was passieren wird, die Verflüssigung der Positionen sind die Grundlage einer möglichen Emergenz von Erkenntnis. Dies ist das eigentliche sokratische Nicht-Wissen (und nicht jene ironische Spielerei, für die es gerne genommen wird). Der/das Moment kann aber ebensogut verfehlt werden (es lässt sich nicht kausal fixieren), das Scheitern ist der Preis, der für diese Möglichkeit zu entrichten ist. Insofern griffe die performative Philosophie auch deutlich zu kurz, wenn sie lediglich eine neue (oder vermeintlich alte) „Ganzheitlichkeit“ beschwörte.
Der Körper und die performative Philosophie
Muss der Körper immer zum Einsatz kommen? Der Philosoph scheut sich, er ist so auf das Wort geeicht, will ganz Geist sein. Dass sein Körper ein Wissen haben könnte, ein Körperwissen, erscheint ihm doch reichlich esoterisch (obwohl das längst ein Gemeinplatz ist). Auch dort, wo am Ende die Rede steht, die Sprache, die Sage, muss ihr die körperliche Erfahrung vorausgehen. Sokrates‘ Fähigkeit, im Gespräch jene magischen Momente zu erzeugen, ist, wenn man so will, ein Resultat seiner posttraumatischen Belastungsstörung aus der Kriegserfahrung (die den Schriftgelehrten Platon und Aristoteles eben fehlte wie allen Philosophen danach). Sicher ist, dass der Aufbau eines Spannungsfeldes als Grundlage möglicher Emergenz von Erkenntnis nicht ohne körperliche Präsenz zu haben ist. Und Spannung, der Begriff legt es nahe, entsteht durch das Aushalten von etwas (hier sei noch einmal auf Marina Abramović verwiesen). Ein Sprechen, das sofort mit Erklärungen und Rechtfertigungen bei der Hand ist, macht diese Spannung zunichte. Es war Sokrates‘ körperliche Präsenz, die seine Gesprächspartner elektrisierte, nicht das, was er sagte (was ja ohnehin nicht viel war). Sokrates hat weder geschrieben noch gelesen, er hat nicht gearbeitet (im Hegelschen Sinne, d.h. sich nicht „gebildet“). Sich des Lesens und Schreibens zu enthalten ist sicherlich ein erster Zugang zur performativen Philosophie; einmal nicht der knechtischen Begierde nachzugeben, sich im Schrifttum zu verewigen. Die performative Philosophie beginnt vielleicht dort: in der Bedeutungslosigkeit. In den sokratischen Absenzen. In der öffentlichen Arbeitsverweigerung, die Eindruck und Ausdruck in eins fallen lässt. Am Ende dann im Spaß, den man sich auf seine Belesenheit macht.
Damit ist zugleich die Konfliktlinie zwischen institutionalisierter/akademischer und performativer Philosophie gezogen: Die Festlegung auf Kriterien von Wissenschaftlichkeit (Referenzen, Deutlichkeit, Schriftlichkeit etc.), die mit einem Anerkennungssystem (Gutachten, Zitierungen, akademische Positionen) verbunden sind, schließen das elektrisierende Moment, die Gefahr nachgerade kategorisch aus. Es sind denn auch eher die akademisch „gescheiterten Existenzen“, die freien Denkerinnen, jene, denen die Gefahr nicht fremd ist, die einen Zugang zum Performativen finden, als die verbeamtete Professorenschaft. Der unverkennbare Antagonismus von Verflüssigung und Status, von Emergenz und Referenz verwehrt der Performerin die akademische Karriere. So wird die performative Philosophie zunächst einmal nur dergestalt Eingang in die Institutionen finden, indem jemand über das Phänomen schreibt – so wie es hier geschieht. Was dem Autor ein gewisses Unbehagen bereitet, kann doch das, was gezeigt werden kann, nicht gesagt werden.